- 30. Oktober 2025
- Intervention
Von Dämonen und Hightech-Computern
An der diesjährigen Info-Veranstaltung der AGV machte der Meteorologe Felix Blumer in einem spannenden Vortrag auf die Relevanz der Wetterprognostik für die Feuerwehrarbeit aufmerksam. Ein zweiter Vortrag von Umweltingenieur Federico Ferrario vermittelte den anwesenden Feuerwehrleuten Hinweise zur Waldbrandbekämpfung. Für Urs Ribi, Abteilungsleiter Intervention, war es der letzte Info-Anlass. Er geht Ende Jahr in Pension.
Die Geschichte der Wettervorhersage lässt sich, grob vereinfacht, in drei Phasen gliedern. Während Jahrhunderten herrschte die Vorstellung vor, Wetterphänomene seien von übernatürlichen Mächten wie Göttern, Geistern oder Dämonen verursacht. Erst ab dem Spätmittelalter werden Wetterereignisse zunehmend als Ausguss natürlicher Kausalwirkungen betrachtet. Volkstümliche Bauernregeln beruhen auf den Wetterlagenerfahrungen von Landwirten. Der klösterliche Verfasser des Hundertjährigen Kalenders, Mauritius Knauer, stütze sich im 17. Jahrhundert für seine berühmtgewordene Prognoseschrift auf die Beobachtung verschiedener Himmelskörper.
Die moderne Wetterkunde schliesslich nimmt ihren Anfang ebenfalls im 17. Jahrhundert mit der Erfindung der ersten physikalischen Messgeräte, die eine systematische Untersuchung der unterschiedlichen Wetterelemente wie Luftdruck und Temperatur erlauben. Heute passiert die Wettervorhersage in erster Linie in den Schaltkreisen von ultraschnellen Supercomputern, die für die Prognosen Myriaden von Datenwerten aus modernen Messstationen verarbeiten.
Der technische Fortschritt der letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, dass Wetterprognosen – auch solche über mehrere Tage – immer präziser werden. Diese zunehmende Verlässlichkeit und Präzision machen die Prognosen auch für die Feuerwehren immer relevanter. Um diese Relevanz aufzuzeigen, hatte die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) den Naturwissenschaftler und Meteorologen Felix Blumer an ihren jährlichen Infoanlass vom 27. August in Wohlen AG eingeladen.
Eine genaue Vorhersage


Blumer arbeitete von 1997 bis 2005 als Kommunikationschef für die Nationale Alarmzentrale. Seit 2005 bis zu diesem Jahr war er als Mitarbeiter von SRF Meteo tätig und ebenfalls seit 2005 ist er Geschäftsführer der Kommunikationsberatungsfirma Blumer CC. In seinem Vortrag erläuterte der 65-jährige Wetterexperte die technischen Finessen moderner Wetterprognosen sowie die Herausforderungen, denen die Meteorologie bei der Interpretation der Prognosedaten begegnet. Extra für den Infoanlass erstellte Blumer eine mehrtägige und, wie sich am 27. August schliesslich zeigen sollte, beeindruckend genaue Vorhersage für Wohlen.
Gleichzeitig machte er auch auf die Grenzen der unterschiedlichen Wettermodelle aufmerksam, auf denen die Prognosen beruhen. «Nach sieben Tagen ist Ende der Fahnenstange», sagte Blumer. «Zwar kann man alles berechnen, aber nach sieben Tagen sind die Vorhersagen schlicht nicht mehr seriös.» Zur Illustration projizierte der Meteorologe eine Wetterkarte auf die Leinwand, auf der die verschiedenen prognostizierten Wetterfronten eher aussahen wie ein Teller farbiger Spaghetti als wie einheitliche, erkennbare Frontverläufe.
Den Feuerwehrleuten im Zuhörersaal an der Kantonsschule Wohlen, in dem der Info-Anlass stattfand, riet Blumer, stets mehrere Wetterdienste – MeteoSchweiz, SRF Meteo und Meteo Centrale sowie den Wetterdienst des Bundesamts für Umwelt (BAFU) – zu konsultieren. «Zeigen gleich mehrere Dienste ein und denselben Trend an, so kann dies als verlässliches Signal gewertet werden.» In Wohlen adressierte Blumer auch die Kritik, Meteorologen würden mit absichtlich falsch generierten Prognosen das Narrativ der Klimaerwärmung pushen, mit den Worten: «Dieser Vorwurf ist absurd. Die Rechenmodelle, welche den Prognosen zugrunde liegen, können gar nicht manipuliert werden.»
Die Problematik und die Herausforderung für die Meteorologen bestünden vielmehr in der Kommunikation der Prognosen. «Sagen wir, die Modelle berechnen für einen bestimmten Tag eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 Prozent für 21 Uhr. Zeigen wir dann das Regensymbol in der Tagesprognose oder nicht?» Dies seien Fragen, mit denen die Mitarbeiter von SRF Meteo täglich konfrontiert seien.
Durchschnittlich vier Waldbrände pro Jahr
Für die Feuerwehren, so Blumer, gelte es, die Prognosen in ihre Planung einzubeziehen. Dies beinhalte zum Beispiel auch, die möglichen Auswirkungen von Starkregenereignissen zu studieren und Bachbette freizuräumen oder die zunehmende Bodenversiegelung in Einsatzübungen zu berücksichtigen. Mit Blick auf den Sturm, der 2013 das Turnfest in Biel verwüstete, einen Menschen das Leben gekostet und für rund hundert verletzte Personen gesorgt hatte, sagte Blumer: «Diese Gewitterzelle konnte drei Stunden lang verfolgt werden. Dann darf so ein Fall schlicht nicht passieren. Wer Verantwortung trägt, muss planen, üben, führen und überzeugend kommunizieren.»
Doch Blumer machte auch klar, dass Stürme sich mitunter einfach zu schnell zusammenbrauen würden. «Hat man dann ein Grossereignis wie zum Beispiel das diesjährige Eidgenössische Schwing- und Älplerfest mit 54000 Menschen in einer Arena, dann kann man nicht mehr reagieren. Hier lautet die Konsequenz, die Veranstaltung zurückzudimensionieren.»
Neben Felix Blumer präsentierte die AGV den im Publikum anwesenden Vertretern der Aargauer Feuerwehren und Gemeinden auch ein Referat von Federico Ferrario vom Umweltingenieurbüro EcoEng AG zum Waldbrandpotential im Kanton Aargau. Anhand der Auswertung statistischer Daten aus dem Zeitraum 1874 bis 2023 lässt sich zeigen, dass im Aargau mit durchschnittlich vier Waldbränden pro Jahr zu rechnen ist, wobei bei diesen Bränden eine Fläche von durchschnittlich 0.77 Hektar betroffen ist. «Die Frequenz der Brände», so Ferrario, «ist im Aargau damit zu klein, um eine Risikodefinition vorzunehmen.»
Trotzdem konnte der Umweltingenieur den Feuerwehrleuten im Saal verschiedene Empfehlungen mit auf den Heimweg geben. Darunter etwa diejenige, vermehrt auch die Förster in die Informationsprozesse und Planungen der Feuerwehr miteinzubeziehen, oder den Wasserbezug für neuralgische Punkte zu prüfen und sicherzustellen. «Auch die restriktive Bewilligung von Feuerstellen in sensitiven Gebieten oder die Anbringung von Infotafeln stellen wichtige präventive Massnahmen dar.» Hanspeter Suter, Abteilungsleiter Intervention Stv. und Leiter Ausbildung bei der AGV, ergänzte die Ausführungen mit dem Hinweis, dass ab 2027 ein Ausbildungsangebot zur Waldbrandbekämpfung zur Verfügung stehen soll.
Gestiegene Anmeldezahlen
Die Info-Veranstaltung in Wohlen dient der AGV auch immer dazu, um auf Aktualitäten aus der Feuerwehrwelt aufmerksam zu machen. Hanspeter Suter führte aus, dass neben der erfolgten Neugestaltung der Kurse für Gruppenführer und Einsatzführung, die gestiegene Anmeldezahlen generieren konnten, sich auch Kurse zur Einsatzführung II (grössere Ereignisse) sowie zur Führungsunterstützung in Planung befänden. Weiter soll das Angebot an Ausrüstungen im Mietmodell um Ausrüstungen für Jugendfeuerwehren ergänzt werden. Der Logowechsel als Teil des neuen Auftritts der AGV wird derweil bis Ende 2026 mit der Umbeschriftung von 2500 Ausrüstungen abgeschlossen und der Neubau des Brandhauses in Eiken wird im Jahr 2027 über die Bühne gehen.
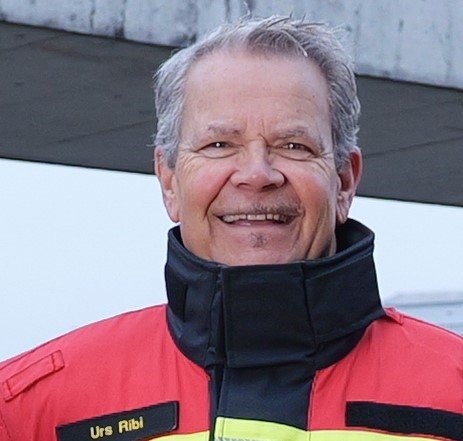
Urs Ribi, Abteilungsleiter Intervention und kantonaler Feuerwehrinspektor bei der AGV, führte am 27. August durch seine letzte Info-Veranstaltung. Er wird Ende Jahr in Pension gehen. In seiner Abschiedsrede bedankte sich Urs Ribi für die Unterstützung, die er bei seiner Arbeit geniessen durfte, und lobte den unermüdlichen Einsatz der Aargauer Feuerwehrleute. «Unser Milizsystem ist der grösste Trumpf der Schweiz. Die wichtigsten Kräfte des Aargauer Feuerwehrwesens sind die Führungspersonen und die AdF unserer Feuerwehren.» Mit diesen Gedanken appellierte er an das Publikum, dem Milizsystem Sorge zu tragen, denn es sei das richtige System im Feuerwehrwesen für den Aargau.
Sein Leitsatz bei seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter, so Ribi weiter, sei es stets gewesen, die Ausbildung der Feuerwehrleute nach dem echten Leben auszurichten. «Alles, was wir gestaltet haben, haben wir einsatzbezogen entwickelt und weiterentwickelt.» Weiter habe die AGV immer auf die Jugend gesetzt. Und so sei er auch besonders stolz auf die 2012 ins Leben gerufenen AGV-Schülertage, die jetzt umbenannt zu den AGV-Erlebnistagen mit moderaten Optimierungen im kommenden Jahr bereits zum sechsten Mal an 20 Einzeltagen veranstaltet werden.
Als Nachfolger von Urs Ribi steht Reto Graber in den Startlöchern. Er wird das Amt des kantonalen Feuerwehrinspektors und des Bereichsleiters Intervention bei der AGV am 1. Januar 2026 antreten und im kommenden Spätsommer durch seine erste Info-Veranstaltung führen.
Autor:
- Bericht eingereicht von Markus Christen, Kantonskorrespondent «118 swissfire»
- Fotos eingereicht von Felix Blumer, SRF Meteo
